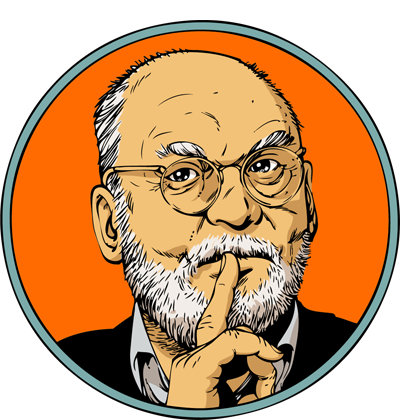© epd-bild/Jens Schulze
Viele Kirchengemeinden bieten in den "Raunächten" zwischen Heiligabend und dem 6. Januar eine meditative Andacht in der "Kirche der Stille" an, wie hier in Hannover.
Einst wurden in dieser Zeit Ställe ausgeräuchert, um angebliche Dämonen zu vertreiben. Im Gespräch erzählt Religionshistorikerin Claudia Jetter von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen über die neue Beliebtheit der Raunächte und das Bedürfnis nach Ritualen.
epd: Frau Jetter, die Bräuche zu den Raunächten sind teilweise viele Jahrhunderte alt. Auch heute begehen manche diese Zeit besonders. Woran liegt das?
Claudia Jetter: Es ist auf jeden Fall eine Zeit mit hoher Symbolkraft. Dabei gibt es eine unterschiedliche Datierung zu den Raunächten. Manche nehmen Bezug auf germanische Götter. Nach ihrer Lesart beginnen die Raunächte mit der Wintersonnenwende vom 21. auf den 22. Dezember. Andere nehmen Bezug auf die Zeit zwischen Heiligabend und dem 6. Januar. Ob mit der Sonnenwende und länger werdenden Tagen, Weihnachten oder Silvester als Beginn des neuen Jahres, für viele steht diese Zeit für einen Neubeginn und neues Leben. Darum eignet sie sich gut für Rituale, ganz egal, ob man christlich geprägt ist oder säkular.
Welche Rituale werden denn gepflegt?
Jetter: Es gibt da Angebote aus ganz verschiedenen Richtungen. Klassisch esoterisch ist etwa das Kartenlegen, um in das neue Jahr zu schauen. Neuheidnische Gruppen wie Hexen arbeiten viel mit Räucherwerk. Es gibt zum Beispiel spezielle Raunächte-Sets mit zwölf verschiedenen Räuchermischungen - für jede Raunacht eine. Einige sind symbolisch mit Reinigung verbunden, andere damit, sich für das neue Jahr etwas zu wünschen.
Auch die Astrologie greift das Thema auf. Und wir finden es im Bereich des sehr verbreiteten spirituellen Coachings. Hinzu kommen Kirchengemeinden, die Angebote machen oder auch ein Buch des 2016 verstorbenen Theologen Jörg Zink mit christlichen Meditationen für diese Zeit.
Was suchen Menschen, wenn sie die Raunächte besonders begehen?
Jetter: Viele Menschen sind nicht mehr bereit, sich regelmäßig in religiösen oder spirituellen Gemeinschaften zu engagieren. Es gibt aber eine hohe Bereitschaft, sich eine Zeit lang zu bestimmten Events spirituellen Praktiken zuzuwenden. Da passt ein solches Datum gut herein.
Es ist ein Moment im Jahr, an dem ich mir Zeit nehme für mich, um zu reflektieren. Dabei geht um eine Art von Psychohygiene, eine Innenschau für einen bestimmten Zeitraum, um sich neu zu sortieren.
"Aber das Bedürfnis nach Ritualen wird gestillt."
Es gibt da einen starken Ich-Bezug. Man braucht gar keine andere Person dazu, um diese Zeit zu begehen. Da kaufe ich mir einfach ein Set mit Anregungen für zwölf Nächte. Ich muss das noch nicht einmal jeden Tag machen, wenn ich zum Beispiel anderes vorhabe und mit Freunden verabredet bin. Aber mein Bedürfnis nach Ritualen wird gestillt.
Sie sprachen von spirituellen Coaches, also Trainern, wenn man so will. Was macht diese aus?
Jetter: Die spirituellen Coaches sind das Produkt der extremen Individualisierung im religiösen und spirituellen Raum. Sie verwenden oft ein weites und vages spirituelles Gerüst, das ziemlich durchlässig ist, damit sich viele darin wiederfinden. Viele betonen, nicht religiös zu sein. Dann verwenden sie zwar bestimmte Praktiken - auch aus religiösen Traditionen, allerdings ohne sich etwa dem Hinduismus oder Buddhismus zugehörig zu fühlen. Das kann auch ein hawaiianisches Vergebungsritual sein, das eigentlich religiös verankert war, aber verkürzt und aus dem Zusammenhang gerissen wird.
Die Coaches legitimieren sich über die Erfahrung, über ihr eigenes Erleben. Sie beschreiben eine persönliche Krise, aus der ihnen ein Ritual oder ein Buch herausgeholfen hat und laden andere ein, daran teilzuhaben. "Wenn ihr möchtet, dann nehme ich euch mit auf die Reise." Vieles läuft über die sozialen Medien.
Aber auch Kirchengemeinden machen Angebote zu den Raunächten, wen erreichen sie?
Jetter: Das ist eine andere Klientel. Viele Menschen haben "zwischen den Jahren" frei und haben Zeit, da können die Kirchen schon Menschen erreichen, die ihnen zumindest noch lose verbunden und christlich verortet sind. Aber es gibt immer mehr junge Menschen, die gar keine frühen Berührungspunkte zur Kirche mehr haben. Die suchen sich wohl eher andere Anbieter.
Was sind die Raunächte?
Als Raunächte, manchmal auch Rauchnächte oder Rauhnächte, werden die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und dem Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar bezeichnet. Vielfach ist auch von der "Zeit zwischen den Jahren" die Rede. Der Begriff leitet sich laut dem Theologen und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti davon ab, dass der Jahresbeginn je nach Gegend und Zeitalter mal am 25. Dezember, mal am 1. Januar und mal am 6. Januar gefeiert wurde.
Ein zentraler Brauch war das Ausräuchern von Haus und Stall, die mit Weihrauch und Weihwasser gegen das Böse gewappnet werden sollten. "Weihrauch ist das Parfum des lieben Gottes", so sagt es Becker-Huberti. Man vermied in den Raunächten zudem etwa das Misten, Spinnen und Nähen und vor allem wurde keine Wäsche aufgehängt, in der Angst, Dämonen könnten sich darin verfangen.
Unklar ist die Herkunft des Begriffs. Die Raunächte, die erst mit der Rechtschreibreform das Binnen-"h" verloren haben, könnten vom "Rauch" stammen. Oder sie könnten - wie die Titelheldin in dem Grimm'schen Märchen "Allerlei-Rauh" in ihrer geflickten Fellkleidung - auf Felle verweisen, die "Rauchwaren" des Kürschnerhandwerks. Denn haarig und struppig wie Wolf und Bär stellte man sich früher jene Dämonen vor, die in den dunklen Tagen um die Jahreswende angeblich ihr Unwesen trieben.