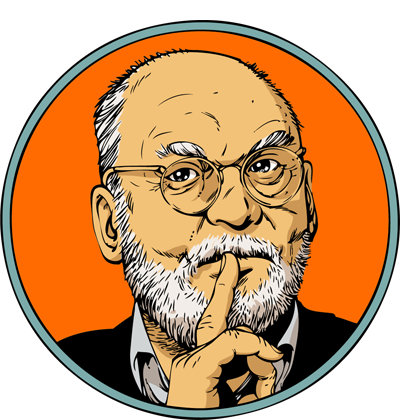Foto: epd-bild/akg-images
Bei dem Soziologen Weber machen viele Politiker Anleihen, wenn sie ihr Tun als das "Bohren dicker Bretter" beschreiben. Auch seine These zum Verhältnis von Calvinismus und Kapitalismus ist keineswegs verstaubt. In Zeiten der Finanzkrise hat der Ruf nach Moral in der Wirtschaft Konjunktur. Braucht es ein Zurück zur protestantischen Ethik, wurde schon nach den ersten Bankencrashs gefragt, muss der Meisterdenker Max Weber neu entdeckt werden?
In Zeiten der Finanzkrise hat der Ruf nach Moral in der Wirtschaft Konjunktur. Braucht es ein Zurück zur protestantischen Ethik, wurde schon nach den ersten Bankencrashs gefragt, muss der Meisterdenker Max Weber neu entdeckt werden? Der Nachhall des großen deutschen Gelehrten, der vor 150 Jahren geboren wurde und mit seinem gewaltigen Werk die Wirtschafts-, Herrschafts- und Religionssoziologie maßgeblich beeinflusste, reicht bis in die Gegenwart.
Max Weber kam am 21. April 1864 als erstes von acht Kindern in Erfurt zur Welt. Aufgewachsen ist er in einem großbürgerlichen kulturprotestantischen Elternhaus in Berlin. Der Vater war Berufspolitiker. Seine Mutter entstammte der protestantisch-pietistischen Familie Fallenstein und war von religiöser Innerlichkeit geprägt. Webers Verhältnis zur Kirche war nicht frei von Spannungen, wie Biograf Dirk Kaesler berichtet. Konfirmiert, 1893 kirchlich getraut, bis zu seinem Tod Mitglied der badischen Landeskirche, war Weber keineswegs ein konventioneller Kirchgänger. Er bezeichnete sich selbst als "religiös unmusikalisch".
In Heidelberg, Berlin und Göttingen studierte Weber Rechtswissenschaft, Philosophie und Ökonomie. Nach Promotion und Habilitation über rechtshistorische Themen stand er 1892 am Anfang einer steilen wissenschaftlichen Karriere. Er arbeitete für den "Verein für Socialpolitik", eine Gruppe von Ökonomen, deren Mitglieder als "Kathedersozialisten" bezeichnet wurden. Über den "Evangelisch-Sozialen Kongress", auf dessen Treffen soziale Missstände aus evangelischer Sicht erörtert werden, war Max Weber freundschaftlich mit dem Pfarrer und liberalen Politiker Friedrich Naumann verbunden.
Sonntäglicher Teezirkel in Heidelberg
Weber wurde Professor für Nationalökonomie in Freiburg im Breisgau, danach in Heidelberg. Im repräsentativen großelterlichen Haus Fallenstein in Heidelberg trafen sich bei Weber Politiker und Wissenschaftler zu sonntäglichen Teezirkeln. Dieser "Weber-Kreis", an dem neben Ernst Troeltsch auch Karl Jaspers, Georg Lukács, Ernst Bloch oder Gustav Radbruch teilnahmen, trug zum "Mythos von Heidelberg" bei. In Heidelberg schrieb Weber seine bedeutendsten Werke, am Neckar blieb er auch nach seiner schweren psychischen Erkrankung, die 1903 zu seiner Pensionierung führte.
Als Privatgelehrter und politischer Beobachter schuf er mit immenser Produktivität ein vielseitiges interdisziplinäres Werk. Im August 1914 meldete sich der 50-Jährige kriegsbegeistert als Reserveleutnant freiwillig, ihm wird die Verwaltung von Reservelazaretten übertragen. "Dieser Krieg ist bei aller Scheußlichkeit doch groß und wunderbar, es lohnt sich, ihn zu erleben", zitiert Biograf Kaesler aus einem Weber-Brief von 1914.
Pflichtlektüre für angehende Soziologen
Zum Klassiker avancierte Max Weber, ein vehementer Kritiker der Passivität der bürgerlichen Schichten, mit dem Aufsatz "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", erschienen 1904/1905. Diese religionssoziologische Fallstudie über den Einfluss des calvinistischen Arbeitsethos auf die Entstehung des modernen Kapitalismus übt bis heute weltweit Faszination aus. Auch wenn mittlerweile die Vorbehalte überwiegen: Der Text gehört für Soziologiestudierende auf der ganzen Welt zur Pflichtlektüre.
Von Politikern wird Webers Vortrag "Politik als Beruf" aus dem Jahr 1919 gerne zitiert. Hierin ging er der Frage nach, "was für ein Mensch man sein muss, um seine Hand in die Speichen des Rades der Geschichte legen zu dürfen". Populär ist vor allem die Feststellung: "Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind für den Politiker: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß. Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich."
Verantwortung oder Gesinnung?
Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) berief sich im Streit über die NATO-Nachrüstung in den 1980er Jahren auf Webers Unterscheidung von Verantwortungs- und Gesinnungsethik. Auch der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering warnte kürzlich mit Blick auf die Finanzkrise, "ohne Verantwortungsethik sind Katastrophen wahrscheinlich".
Nach dem Ende der wilhelminischen Zeit drängte es Weber selbst in die Politik. Er gehörte zu den Mitbegründern der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Auch war er als Sachverständiger der deutschen Delegation an den Versailler Friedensverhandlungen beteiligt. Die Revolutionswirren der Münchner Räterepublik waren ihm ein Graus: Bei seinen Ratschlägen für die Weimarer Verfassung machte Weber sich für eine Direktwahl des Reichspräsidenten und die Notstandsartikel stark. In einem neueren Sinne sei Max Weber sicher kein Demokrat gewesen, urteilte der Soziologe Ralf Dahrendorf (1929-2009).
Im Alter von gerade 56 Jahren starb Max Weber am 20. Juni 1920 in München an den Folgen einer Lungenentzündung. "Er war in der tiefsten Seele Politiker, eine Herrschernatur und ein glühender Patriot", schrieb der Theologe und Politiker Ernst Troeltsch in einem Nachruf.
Literatur zum Thema
Dirk Kaesler: Max Weber - Preuße, Denker, Muttersohn. Eine Biographie, München 2014. C. H. Beck Verlag, 1.007 Seiten, 38 Euro.
Jürgen Kaube: Max Weber - Ein Leben zwischen den Epochen, Hamburg 2014. Rowohlt Verlag, 496 Seiten, 26,95 Euro.
"Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus"
Der 1904/1905 veröffentlichte Aufsatz gilt heute als berühmtestes Werk Max Webers. Seine These besagt, dass der Calvinismus das neuzeitliche Arbeitsethos sowie die Kapitalbildung und somit die Entstehung des modernen Kapitalismus gefördert hat. "Die Hinwendung zur wissenschaftlichen Bemächtigung der Welt, die Verbindung von rational geplantem Gewinnstreben und bewusstem Konsumverzicht sowie eine individualistische Vorstellung von beruflichem Erfolg finden auf diese Weise Eingang in die moderne Wirtschaftsethik", so der Sozialethiker Wolfgang Huber.
Doch Einwände gegen die These gab es nicht nur von zeitgenössischen Nationalökonomen wie Werner Sombart und Lujo Brentano. Der Historiker Felix Carl Rachfahl warf Weber vor, über die calvinistischen Niederlande nicht genügend Bescheid zu wissen. Auch aus Skandinavien und Großbritannien kam Widerspruch. Wirtschaftshistoriker argumentierten, auch in katholischen Staaten ließen sich kapitalistische Ansätze nachweisen. Hingegen sorgte der US-Soziologe Talcott Parsons durch seine 1930 erschienene Übersetzung der These für eine Aufnahme der Ideen in Nordamerika.
Mittlerweile überwiegen die Vorbehalte gegen den Zusammenhang von protestantischer Ethik und Kapitalismus. Aber die Kritik habe Weber nur noch populärer gemacht, folgert der Historiker Hartmut Lehmann. Für Studierende gehöre der Text mit den einprägsamen Sprachbildern vom "stahlharten Gehäuse", vom "Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz" noch immer zur Pflichtlektüre. Vielleicht liege Webers eigentlicher Beitrag darin, "dass er durch eine teilweise (?) falsche Antwort viele Wissenschaftler angeregt hat, nach einer besseren, einer überzeugenderen Antwort zu suchen", findet Lehmann.