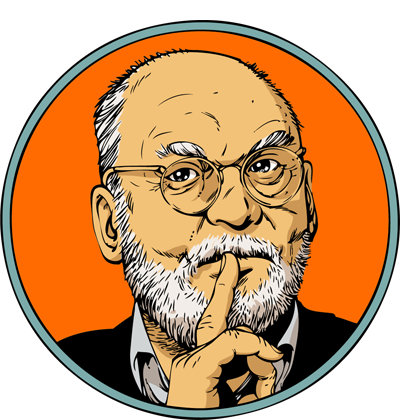© epd-bild/Jens Schlueter
Die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, spricht im Plenum der EKD-Synode in Magdeburg am 06. November 2022. Sie sagte "Unsere Welt gerät in schweres Wasser."
Um die Situation der evangelischen Kirche zu beschreiben, wählt eine ihrer höchsten Vertreterinnen das Bild einer Slackline. Das ist ein gurtähnliches Sportgerät, das man zwischen zwei Bäume spannt, um darauf zu balancieren. Die Line wackelt gewaltig. Meist fällt man herunter, bevor man den nächsten Baum erreicht. Selten tut man sich dabei wirklich weh, weil Slacken in der Regel eine Gemeinschaftsaktion ist. Es ist meist jemand da, der einen auffängt. So in etwa will die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auch ihre Kirche verstanden wissen, als "Halt in aller Unsicherheit", so formuliert es Anna-Nicole Heinrich am Sonntag in Magdeburg.
Bis Mittwoch tagt in Magdeburg das Kirchenparlament, berät über interne Fragen wie den Haushalt, die eigene Verantwortung beim Thema Klimawandel, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, die Friedensethik angesichts des brutalen Kriegs in der Ukraine und über die eigene Rolle in einer Gesellschaft, in der immer weniger Menschen zu einer Kirche gehören. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung ist inzwischen Mitglied einer Kirche.
Die Synode tagt dort, "wo es deutschlandweit die wenigsten Christen gibt", sagte die Kulturministerin Sachsen-Anhalts, Eva Feußner (CDU), in ihrem Grußwort zu Beginn der Tagung am Sonntag. Sie appellierte zugleich: "Lassen Sie sich nicht davon abschrecken!" Die Kirche werde gebraucht.
Das sieht freilich auch die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, so. Seit einem Jahr ist sie die höchste Repräsentantin der 19,7 Millionen deutschen Protestanten. Vor ihrer Wahl hatte die evangelische Kirche gerade einen umfangreichen Reformprozess beschlossen. Fragen nach der eigenen Relevanz bestimmten nahezu jede Synodentagung.
Kurschus will nun einen anderen Akzent setzen. Die Frage, wozu die Kirche gebraucht werde, "stellt eine Falle", sagte sie in ihrem Bericht vor der Synode. "Sie verführt dazu, permanent um unsere eigene Relevanz zu kreiseln", warnte die westfälische Präses. Die evangelische Theologin sprach sich dafür aus, sich aus "vertrauten Denkmustern" und "bewährten Traditionen" hinauszubewegen. "Ins Tiefe" will sie sich wagen, sagte sie. Auch das klingt ein bisschen nach Slackline.
Vor wenigen Tagen hatte Kurschus mit einem Appell für Gespräche über einen Waffenstillstand in der Ukraine für Aufsehen gesorgt. Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hatte sie dafür scharf kritisiert. Am Sonntag bekräftigte Kurschus unbeirrt ihre Haltung. Diplomatische Bemühungen, um einen Waffenstillstand zu ermöglichen, müssten zwingend hinzukommen zur Solidarität mit der Ukraine und deren militärischer Unterstützung. Letztere stellt Kurschus nicht infrage, anders als der EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer, der sein Nein zu Waffenlieferungen am Sonntag nochmals bekräftigte.
An einem hochaktuellen und kontroversen Thema mangelt es der Synode in Magdeburg damit nicht. Auch ein besonderer Gast wird erwartet: Die Synode hat die Klimaaktivistin Aimée van Baalen eingeladen. Sie ist Vertreterin der Bewegung "Letzte Generation", die mit Straßenblockaden, Farbattacken auf Parteizentralen und Lebensmittelwürfe auf Kunstwerke für Schlagzeilen und Kritik sorgt. Kurschus deutete zudem an, dass sie und andere Vertreterinnen und Vertreter der Kirche bei einer für Montag in Magdeburg angekündigten Demonstration gegen die Energiepolitik der Bundesregierung das Gespräch suchen wollen.
Statt nur über Relevanz zu reden, wollen die Spitzenrepräsentantinnen der Kirche bei der Synode in Magdeburg auch Relevanz beweisen. "Wir werden gebraucht als Institution", betonte Kurschus vor den 128 Synodalen. Auch deshalb, so kann man sie verstehen, muss sich die Kirche reformieren und entwickeln - oder, wenn man es mit den Worten der Präses Heinrich sagt: "fortbewegen, selbst wenn die Slackline unter uns wackelt".
In diesem Video erfahren Sie alles Grundlegende über die Synode und wie sie sich zusammensetzt:
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist die Gemeinschaft der 20 evangelischen Landeskirchen in der Bundesrepublik mit rund 19,7 Millionen Protestanten. Wichtigste Leitungsgremien sind die EKD-Synode mit 128 Mitgliedern, die Kirchenkonferenz mit Vertretern der Landeskirchen sowie der aus 15 ehrenamtlichen Mitgliedern bestehende Rat. Ratsvorsitzende ist die westfälische Präses Annette Kurschus.
Die EKD wurde 1945 als Zusammenschluss lutherischer, reformierter und unierter Landeskirchen ins Leben gerufen. Die einzelnen Landeskirchen sind selbstständig, die EKD koordiniert jedoch das einheitliche Handeln. Ihre Aufgaben liegen vor allem bei Fragen der öffentlichen Verantwortung der Kirche und bei den Beziehungen zu den Partnerkirchen im Ausland. Zudem ist die EKD zuständig für die Herausgabe der Lutherbibel und des Gesangbuchs. Sie veröffentlicht regelmäßig Denkschriften zu ethischen, sozialen, politischen und theologischen Themen.
Die Teilung Deutschlands hatte 1969 auch für die evangelische Kirche eine organisatorische Trennung zur Folge. Nach der politischen Wiedervereinigung schlossen sich 1991 die evangelischen Kirchen in Ost- und Westdeutschland wieder zusammen. Anfang 2007 wurde eine Strukturreform wirksam, die auf eine enge Verzahnung der Organe und Dienststellen von EKD und konfessionellen Zusammenschlüssen der Lutheraner und Unierten abzielt. Seit 2009 tagen daher EKD-Synode, die lutherische Generalsynode und die Vollkonferenz der unierten Kirchen zeitlich und personell verzahnt am gleichen Ort.