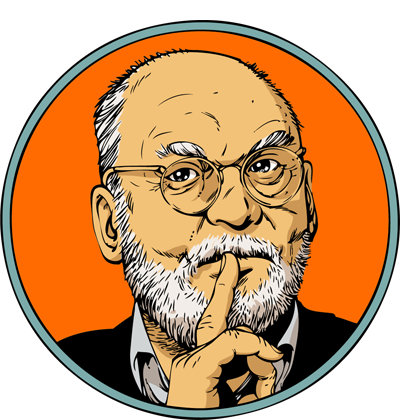© Rodrigo Abd/AP/dpa
Anatoliy Morykin (l.) trauert um seine Mutter, während weitere Männer ein Grab schaufeln. Die Mutter Valentyna Morykina starb aufgrund der schlechten Lebensbedingungen während der russischen Invasion in Butscha in einem Altersheim.
Die EKD-Ratsvorsitzende erklärte am Mittwoch in Bielefeld: "Jesus ist ein Leidensgenosse der Menschen, die dort von Soldaten gefangengenommen, gefoltert und getötet werden", führte die Theologin aus. Das Kreuz vom Karfreitag stehe für das Schlimmste und Brutalste, was Menschen einander antun können.
Jesus sei "ein Leidensgenosse derer, mit denen die Schergen der Kriegsherren ihren Mutwillen treiben und die aus kaltherzigem Machtkalkül geopfert werden", fügte die Ratsvorsitzende hinzu: "Und wie Jesus rufen, denken, seufzen viele: Mein Gott, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen?"
Der Karfreitag mute den Menschen zu, der Verzweiflung der Leidenden bis in die tiefste Tiefe nachzugehen und denen, die von ihr überwältigt sind, beizustehen, sagte Kurschus. Gott selbst stelle sich in Jesus an die Seite derer, die sich von Gott verlassen wähnen.
In diesem Jahr treffe die Botschaft des Karfreitags zudem auf Menschen, die von der langen Zeit der Corona-Pandemie erschöpft sind, erklärte die EKD-Ratsvorsitzende: Menschen, die Angst vor dem Krieg im Osten Europas haben, die wütend seien auf den "skrupellosen russischen Präsidenten Putin und dessen brutalen Angriffskrieg". Menschen, die Mitleid hätten mit den Opfern auf beiden Seiten des Krieges.
Viele von ihnen fragen sich laut Kurschus: Stimmt es wirklich mit der Botschaft vom Leben, das stärker ist als der Tod? Der Tod mit seiner "zerstörerischen Macht wird weder schöngeredet noch ausgeblendet. Die Botschaft von der Leidensgenossenschaft Jesu mit den Gemarterten trifft mitten hinein in das schiere Entsetzen, das der Tod verbreitet", bekennt die Theologin.
Kurschus fügte hinzu: "Am Kreuz setzt der Tod seinen Stachel ins Leben Gottes. Und da muss er ihn lassen, wie ein giftiges Insekt. Am Ende wird das Leben siegen." Doch an Karfreitag "will die elende Todesnot ausgehalten sein".
Am Karfreitag erinnern Christ:innen an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Karfreitag wird damit in Verbindung mit Ostern, der Feier der Auferstehung Jesu, zu einem zentralen kirchlichen Feier- und Gedenktag. Für evangelische Christ:innen hat der Karfreitag eine besonders große Bedeutung. Er ist zudem ein sogenannter stiller Feiertag.
In der Bibel wird die Geschichte erzählt, wie Jesus, nachdem er von einem seiner Jünger an seine Widersacher verraten wurde, in Jerusalem zum Tod durch das Kreuz verurteilt wird. Die Kreuzigung war damals die grausamste Art der Hinrichtung. Jesus muss sein Kreuz zur Todesstätte außerhalb der Stadtmauern selbst tragen, aus Spott wird ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt. Schließlich wird Jesus ans Kreuz genagelt und stirbt. Das Christentum wurde so zur Religion des Kreuzes.
Viele Christ:innen finden Trost darin, dass Gott das Leid der Menschheit kennt und sich ihm selbst aussetzt. Weil Gott Jesus am dritten Tag nach seinem Tod auferweckt, glauben Christ:innen, dass Jesus Gewalt, Schmerzen und Tod ein für alle Mal überwunden hat und somit das Leben über den Tod gesiegt hat. Viele Christ:innen verstehen seinen Tod auch als Sühne, indem er die Sünden der Menschen auf sich genommen und sie dadurch mit Gott versöhnt hat. Die Vorstellung, Jesus sei ein Opfer, das stellvertretend zur Sühne erbracht wurde, wird heute theologisch unterschiedlich interpretiert.
Die Leidensgeschichte Jesu, auch Passion genannt, ist zentraler Bestandteil aller biblischen Evangelien. Auf sie läuft Jesu Geschichte hinaus und aus ihr lässt sie sich verstehen. So wird die Passionsgeschichte zu einer "Grunderzählung" des Christentums. Entsprechend oft wurde sie in Musik und Kunst rezipiert, etwa in den großen Oratorien von Johann Sebastian Bach. Die Kehrseite der Passionsgeschichte ist die Förderung eines christlichen Antijudaismus. Christen gaben Juden in der Folge häufig die Schuld an Jesu Kreuzigung. Heute lehnen die katholische und die evangelische Kirche jede Form von Antijudaismus ab.
In den meisten Gemeinden schweigen am Karfreitag die Kirchenglocken. Taufen oder Trauungen finden nicht statt. In einigen katholisch geprägten Gegenden tritt an die Stelle des Morgen-, Mittag-, und Abendgeläuts der Brauch, mit Ratschen und Klappern durch die Straßen zu ziehen. Gottesdienste werden oft gegen 15 Uhr zur Todesstunde Jesu gefeiert. Manchmal sind der Altar und das Kreuz verhängt.
Öffentliche Sportveranstaltungen, Jahrmärkte, Musik- und Tanzveranstaltungen fallen am Karfreitag aus. Auch Kinos und Theater müssen ihr Programm dem stillen Charakter des Tages anpassen, wie es in den Feiertagsgesetzen der Bundesländer heißt. Diskotheken und Spielkasinos müssen vielerorts schließen. Darum gibt es gesellschaftliche Diskussionen, weil insbesondere nicht-gläubige Menschen sich in ihren Grundrechten eingeschränkt fühlen.