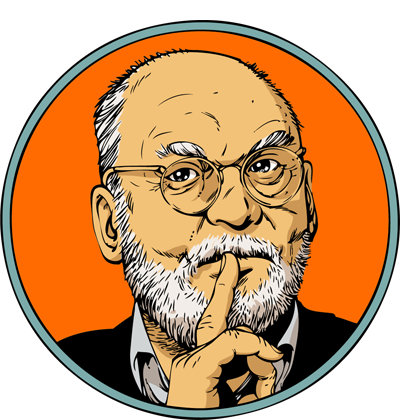© epd-bild/Juergen Blume
Diakoniepräsident Ulrich Lilie äußert sich zum assistierten Suizid: Prävention sei für das erste Gebot, es gebe aber auch andere Aspekte.
epd: Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar das Verbot organisierter Suizidassistenz gekippt. Das Urteil widerspricht Grundsätzen, die in der evangelischen Kirche und der Diakonie bislang galten. Gibt es bei Ihnen jetzt eine Neupositionierung?
Ulrich Lilie: Wir haben mit sehr vielen Menschen zu tun, die das Urteil betrifft. Schon deswegen könnten wir es nicht ignorieren. Und wir respektieren die höchstrichterliche Rechtsprechung, die es nun so verantwortungsvoll wie möglich zu gestalten gilt. Innerhalb der Diakonie hat eine Expertengruppe diskutiert, wie wir mit dem Urteil umgehen, und ein Grundlagenpapier erstellt, in dem die bleibenden Dilemmata bei dem Thema deutlich werden.
Zu welchem Ergebnis kommt das Papier?
Lilie: Zuerst wollen wir als Diakonie mit all unseren Möglichkeiten weiterhin dafür sorgen, dass möglichst selten eine Situation eintritt, in der Menschen wirklich nichts anderes mehr einfällt, als dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Dazu gehören hospizliche, palliative, psychotherapeutische Beratung und Begleitung, Seelsorge und Lebensberatung. Prävention ist also das erste Gebot für uns.
"Wir begleiten alle Menschen, auch diejenigen, die trotz all dieser Angebote den Weg des assistierten Suizids wählen."
Danach sagen wir aber auch: Wir begleiten alle Menschen, auch diejenigen, die trotz all dieser Angebote den Weg des assistierten Suizids wählen. Denn es gibt nicht wegzuschaffendes Leid und Situationen von existenzieller körperlicher und psychischer Not, die für die Betroffenen ausweglos sind. Auch diese Menschen lassen wir nicht allein. Wollen wir sie in so einer Situation wieder nach Hause schicken und sich selbst überlassen?
Das heißt konkret, Suizidassistenz wird auch in evangelischen Einrichtungen möglich sein?
Lilie: Ich denke, wenn Menschen in einer für sie so völlig ausweglosen Situation sind, begleiten wir auch sie. Ich selbst habe ungefähr 20 Jahre lang an Kranken- und Sterbebetten Patienten, Angehörige und Mitarbeiterteams begleitet. Dabei habe ich auch immer wieder erlebt, dass es trotz Palliativmedizin und psychotherapeutischer und seelsorglicher Versorgung ausweglose Situationen gibt. Wenn dann Menschen sagen, dass sie ein Ende des nicht mehr aushaltbaren und kaum zu lindernden Leids wollen, sollten wir das respektieren. Denn Freiheit und Würde gelten auch am Lebensende.
Haben Sie in ihrer Zeit der Begleitung Sterbender selbst assistierten Suizid erlebt?
Lilie: In allen Krankenhäusern, Tumorzentren und überall anders, wo Menschen mit schwersten Krankheiten zu tun haben, gibt es immer wieder Grenzsituationen, Graubereiche. Das kann niemand seriös bestreiten. Assistierten Suizid habe ich nicht erlebt. In dem Hospiz, das ich viele Jahre zusammen mit einer Kollegin geleitet habe, haben wir mit als erste in Deutschland einen Standard für palliative Sedierung in extremen Situationen entwickelt, trotzdem erinnere ich Menschen, die nur noch sterben wollten. Die Frage ist nun, wie wir mit solchen Wünschen umgehen in einer Zeit des zunehmenden Kostendrucks auf das Gesundheitssystem und der Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Es darf auf keinen Fall dazu kommen, dass ökonomische Argumente oder ein gespiegeltes Selbstwertgefühl, das vermittelt, man sei zu nichts mehr gut, eine Motivation für den Suizid darstellen. Das wäre fatal. Deshalb noch einmal: Das erste Gebot für uns lautet Prävention - auf allen denkbaren Ebenen.
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und auch die katholische Bischofskonferenz haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Dammbruch gewertet. Gibt es einen Konflikt zwischen der Leitung der EKD und der Leitung der Diakonie?
Lilie: Dieses Urteil stellt durch höchstrichterliche Rechtsprechung eine Gestaltungsaufgabe, an der wir in einem Rechtsstaat nicht vorbeikommen. Es ist doch keine überzeugende Lösung, wenn wir sagen, wir halten uns in den evangelischen Einrichtungen die Augen zu. Ich war bei den Beratungen im Rat der EKD dabei und habe schon damals gesagt, dass wir die aufgeworfenen Fragen für unsere Einrichtungen beantworten müssen und dass eine rein moralische Position dafür nicht ausreicht. Wir müssen dabei sehr umsichtig und vorsichtig sein, weil wir als Kirche selbst eine doppelte Schuldgeschichte mit diesem Thema haben. Wir haben der menschenverachtenden "Euthanasie" der Nazis auch in unseren Einrichtungen nicht flächendeckend die Stirn geboten, weder in der Kirche noch in der Diakonie. Deswegen brauchen wir sehr transparente Verfahren und auch ein legislatives Schutzkonzept für alle, die an diesen schwierigen Entscheidungen beteiligt sind. Und gleichzeitig haben wir eben auch eine schreckliche Geschichte der Stigmatisierung von Menschen, die sich in verzweifelten Situationen umgebracht haben.
Was würden Sie sich von einem Sterbehilfe-Gesetz oder einem Schutzkonzept des Gesetzgebers wünschen?
Lilie: Unser erstes Gebot habe ich genannt: Prävention. Dann muss es zwingend Beratungsangebote geben und zuletzt bin ich der Auffassung, dass die Entscheidung nicht nur zwischen Arzt und Patient getroffen werden kann. Wir brauchen multiprofessionelle Teams.
"Wir sagen klar Nein zu geschäftsmäßigen Organisationen, die irgendwann das Zimmer betreten und eine Dynamik auslösen, bei der es keine Möglichkeit zur Umkehr mehr gibt."
Das heißt auch: Wir sagen klar Nein zu geschäftsmäßigen Organisationen, die irgendwann das Zimmer betreten und eine Dynamik auslösen, bei der es keine Möglichkeit zur Umkehr mehr gibt. Bis zuletzt muss jemand die Möglichkeit haben zu sagen: Ich habe es mir anders überlegt. Auch wenn das Medikament schon auf dem Tisch steht. Das habe ich eben in meinem Berufsleben auch erlebt: Es gibt immer wieder einen Grund, warum man am Leben bleiben will. Und manchmal meldet der sich ganz plötzlich.
Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja genau diesen geschäftsmäßig handelnden Organisationen Recht gegeben. Wie wollen sie die ausschließen?
Lilie: Das Urteil sagt, es könne "Dritten" die Beihilfe nicht verboten werden. Wir müssen nun darüber reden, wer diese Dritten sind. Ich bin der Meinung, dass es Ärzte sein sollten - nach Beratungen der Betroffenen und im besten Fall auch mit An - oder Zugehörigen in einem interdisziplinären Team. Diese Diskussion gibt es ja auch in der Bundesärztekammer, in der eine nach meiner Beobachtung nennenswert große Gruppe durchaus der Meinung ist, dass assistierter Suizid in Verbindung mit einem Schutzkonzept ärztliche Mitverantwortung sein kann, die nicht im Konflikt steht mit dem ärztlichen Eid. Um das aber auch klar zu sagen: Man darf niemanden dazu zwingen. Das gilt für Ärzte genauso wie für Mitarbeitende in unseren Einrichtungen.
Die Argumentation der Kirchen gegen die Möglichkeit des organisierten assistierten Suizids lautet, diese könne Menschen unter Druck setzen, um keine Belastung für andere zu sein. Wie sehen Sie das?
Lilie: Zu einem gesellschaftlichen Klima, das Suizide verhindert, gehört es, Menschen - so weit möglich - die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Ich kämpfe seit langem dafür, dass in jedem Altenheim eine Fachkraft für Palliativversorgung selbstverständlich ist. Das ist nicht der Fall - und daran krankt am Ende auch die Glaubwürdigkeit der Debatte um das gesellschaftliche Klima, das wir schaffen müssen. Zudem warne ich vor einer paternalistischen Haltung, die Leidenden sagt: Wir wissen schon, was gut für dich ist. Das halte ich ethisch und seelsorglich für fragwürdig. Ich jedenfalls mache mir solch eine Haltung nicht zu eigen, selbst wenn der assistierte Suizid für mich persönlich keine Option ist. Denn am Ende kann ich mir keinen barmherzigen Gott im Himmel vorstellen, der nicht auch zu jenen verzweifelten Menschen sagt: Ich habe deine Not gesehen, meine Arme sind offen.
Stichwort Sterbehilfe: Als Sterbehilfe wird jede Form der Unterstützung beim Sterben verstanden - von der Befreiung von Schmerzen bis zur aktiven Tötung. Meist wird zwischen passiver, indirekter und aktiver Sterbehilfe unterschieden. Der Deutsche Ethikrat hält diese Begriffe allerdings für nicht trennscharf genug. In einer Stellungnahme aus dem Jahr 2006 differenziert er zwischen Sterbebegleitung, Sterbenlassen, Tötung auf Verlangen - und dem Spezialfall assistierter Suizid, um den es in der aktuellen Diskussion geht.
Unter Sterbenlassen wird verstanden, wenn lebensverlängernde Maßnahmen bei todkranken Patienten reduziert oder abgebrochen werden. Das kann das Einstellen der künstlichen Beatmung oder Ernährung sein. Das Sterbenlassen ist straffrei und sogar rechtlich geboten, wenn der Patient dies vorher geäußert oder veranlasst hat.
Unter Sterbebegleitung fasst der Ethikrat alle Therapien, die am Lebensende Schmerzen und Leiden lindern helfen. Darunter fallen auch Therapien, bei der die schmerzlindernde Medikation dazu führt, dass der Kranke schneller stirbt - früher als indirekte Sterbehilfe bezeichnet. Sie gilt als weitgehend zulässig.
Wer einem Sterbewilligen ein Medikament verabreicht, etwa spritzt, begeht Tötung auf Verlangen - und damit aktive Sterbehilfe. Sie ist in Deutschland nach Paragraf 216 strafbar. Tötung auf Verlangen wird mit mindestens sechs Monaten und höchstens fünf Jahren Gefängnisstrafe geahndet.
Beim Sonderfall assistierter Suizid wird einem Sterbewilligen ein todbringendes Mittel überlassen, nicht aber verabreicht. Weil der Betroffene die Handlung selbst begeht und der Suizid in Deutschland nicht strafbar ist, ist auch die Hilfe dabei nicht illegal. 2015 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, dass die "geschäftsmäßige", also auf Wiederholung angelegte Suizidbeihilfe unter Strafe stellte, um die Tätigkeit von Sterbehilfeorganisationen zu unterbinden. Diesen Strafrechtsparagrafen kassierte im Februar das Bundesverfassungsgericht.
Die Karlsruher Richter sehen ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das auch das Recht einschließt, sich das Leben zu nehmen und dabei die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Ob die Politik ein neues Gesetz auf den Weg bringt, etwa um Kriterien für organisierte Hilfe beim Suizid zu definieren oder Maßnahmen zur Suizidprävention zu stärken, ist noch offen.