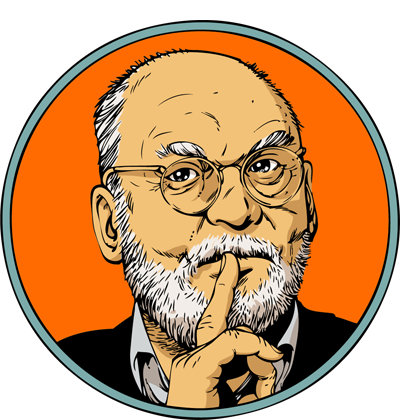Foto: dpa/Uli Deck
Dem Bundesgesetzgeber fehle die Gesetzgebungskompetenz für das Betreuungsgeld, sagte der Vorsitzende des Ersten Senats, Ferdinand Kirchhof. Das Betreuungsgeld war vor allem auf Drängen der CSU im August 2013 eingeführt worden. Die SPD lehnte es zunächst ab, trug es in der großen Koalition aber mit. Der Erste Senat des höchsten deutschen Gerichts entschied, dass die Länder für ein Betreuungsgeld zuständig sind. Das Betreuungsgeld diene nicht der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, heißt es in dem einstimmig gefällten Urteil.
Seit August 2013 erhielten Eltern pro Kind monatlich 150 Euro, wenn das Kind nicht in einer staatlich unterstützten Kindertagesstätte oder in einer Tagespflege betreut wurde. Die Eltern konnten die staatliche Leistung vom ersten Tag des 15. Lebensmonats des Kindes bis zum Ende des 36. Lebensmonats beanspruchen.